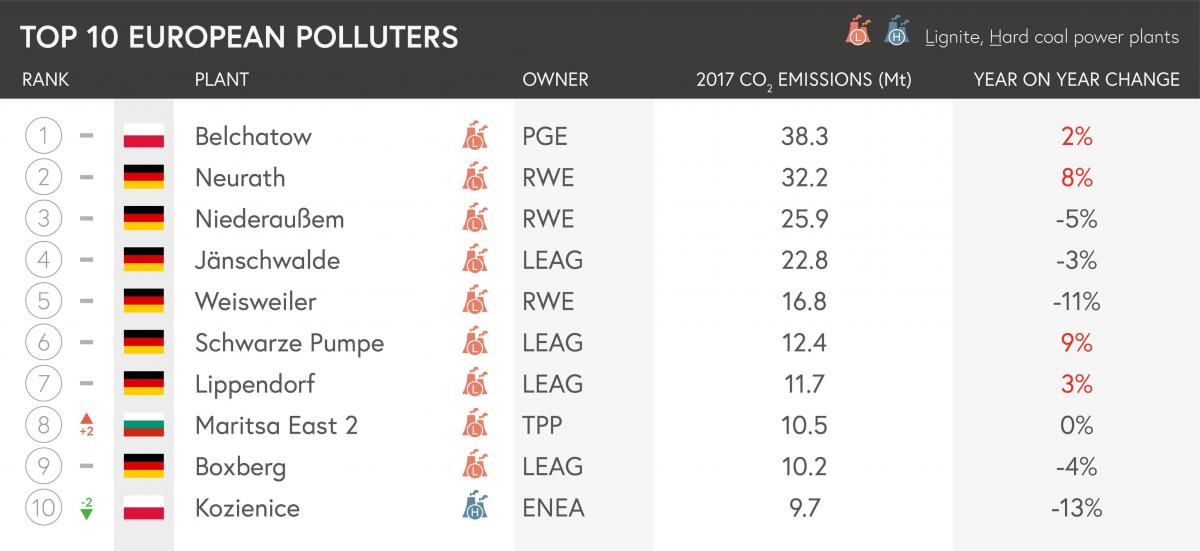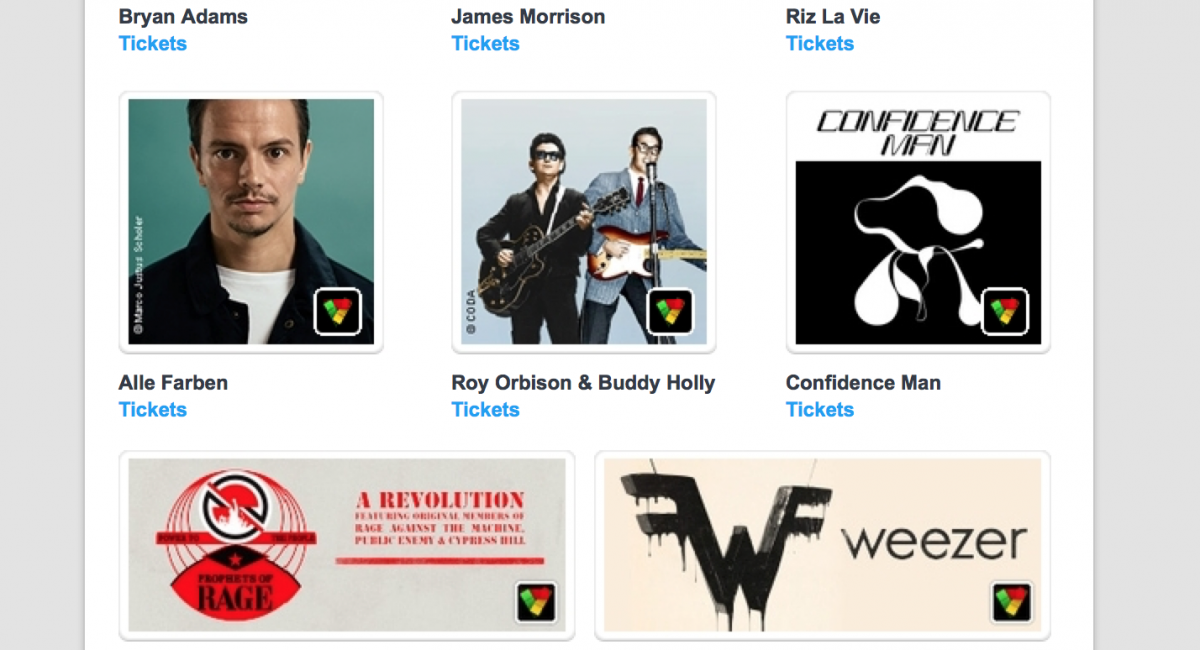Der „Tagesspiegel“ hat in einer Titelgeschichte seines Magazins „Berliner“ die Kunst-Sammlerin Julia Stoschek porträtiert. Eine Mischung aus Home- und PR-Story – „Zwei große Ausstellungshäuser voller Videokunst. Amerikanischer Glamour. Große Inszenierungen. Und sehr viel Geld. Wer ist die Kunstsammlerin Julia Stoschek?“
Aber auch für unsere Zwecke bringt die Story Erkenntnisgewinn.
„Julia Stoschek wurde hineingeboren in eine Industriellenfamilie. Brose Fahrzeugteile. 6,3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018. Sie ist Gesellschafterin.“ Einer Firma, die von Stoscheks Urgroßvater Max Brose gegründet wurde, der seit 1933 NSDAP-Mitglied war und eine Stütze des NS-Systems, Wehrwirtschaftsführer, „Eigentümer einer der ersten Hitler-Büsten überhaupt“, und natürlich beschäftigte die Firma „kriegsgefangene Zwangsarbeiter“, Basis des heutigen Profits.
Aber ihre Sammelleidenschaft hat natürlich nichts mit ihrem Geld zu tun: „Es reicht nicht, ‚die finanziellen Mittel’ zu haben. Man muß auch das Vertrauen der Künstler, der Galerien gewinnen. Professionell sein. Sich etablieren. Und man muß einen Namen haben.“
Und dann die rührende Geschichte der mit Kunst in Berührung kommenden Unternehmertochter: „Sie lernt den Fotografen Andreas Gursky kennen. Sie werden ein Paar. Sie zieht in seine Heimat Düsseldorf, sie eröffnet eine Galerie und verkauft: nichts. Also beginnt sie zu besitzen. Mehr, immer mehr, von dem, was sie fasziniert.“
So ist das, wir kennen das alle, eine typische Alltagsgeschichte, man eröffnet eine Galerie, verkauft nichts, also „beginnt man zu besitzen“, wie es eben so ist, und das hat natürlich nichts damit zu tun, daß Frau Stoschek über „die finanziellen Mittel“ verfügt, überhaupt nicht. Jede*r kann eine Galerie eröffnen, nichts verkaufen und stattdessen eben die Kunst besitzen, die man eigentlich zum Verkauf anbietet. Denn die Kunst ist bekanntlich umsonst, Galerieräume kosten keine Miete, und Galeristen können von Luft und Liebe leben...
So ist das mit der gefeierten Galeristin, die „mit dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, Mathias Döpfner, ein Kind hat“ und „in verschiedenen Welten wandelt. Die Familie, in der sie aufgewachsen ist, ist ihr Fundament und Wand. Die Kunst ist ihr Fenster. Ihren Reichtum nutzt sie, um den Blick durch dieses Fenster mit anderen zu teilen.“
Ich glaube, man nennt dieses Geschäftsmodell neuerdings Sharing Economy – oder habe ich da wieder mal was mißverstanden?